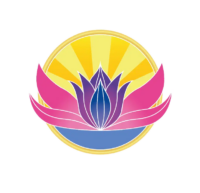Ich komme relativ frisch aus einer Phase, in der ich mich eigentlich konsequent selbst überfordert habe. Die letzten Monate habe ich mir viel zu viel aufgebürdet und nicht gut auf mich geachtet. Ich hatte mehrere Projekte gleichzeitig zu wuppen: von einem Theaterstück, über zwei Ehrenämter, meinem Studium, einer Beziehung, der Organisation eines Ferienjobs sowie Praktikums, dem WG-Leben und nebenbei noch Freund:innen finden, den Haushalt auf die Reihe kriegen und – achja – schlafen und essen muss man ja auch mal. Kurzum: es war einfach alles zu viel.
Die Tragweite dessen wurde mir erst so richtig bewusst, als die größte Welle eigentlich schon über mich geschwappt war und das Chaos am Abklingen. Ich neige nämlich dazu, in solchen Phasen das Augen-zu-und-durch-Prinzip zu fahren und einfach auf den Funktionieren-Modus zu schalten. Und das Dumme oder auch Gute ist (wer weiß), dass es funktioniert. Irgendwie schaffe ich es, alles zu wuppen, zu organisieren, zu handeln und habe natürlich auch immer noch ein offenes Ohr für andere, ein Lächeln auf den Lippen, bin hilfsbereit, wo ich nur kann, und scheine mein Leben prima auf der Kette zu haben. Also was solls?!
Der Preis für das ewige Funktionieren
Naja… Aber was ist der Preis für all das? Was passiert mit mir und meinem Inneren, wenn ich langfristig oder sogar dauerhaft so mit mir umgehe? Ich werde aggressiv. Meine Zündschnur wird immer kürzer und das bekommen vor allem die zu spüren, die mir am nächsten stehen und das am wenigsten verdient haben. Die Härte, die ich mir selbst gegenüber an den Tag lege, verschiebe ich ins Außen und gebe damit meine Verantwortung ab, mich gut um mich zu kümmern.
Statt konstruktiv meine Bedürfnisse, Wünsche und Vorstellungen in den Kontakt zu bringen, erwarte ich vom Außen, in meinem Engagement gesehen und ein Stück weit daraus errettet zu werden. Statt mich erwachsen mitzuteilen, schlage ich verbal um mich wie ein Kind, dass das heißersehnte Eis nicht bekommt, wenn diese Anerkennung ausbleibt. Ich erkenne mich dann selbst nicht wieder. Ich begebe mich daraufhin auf die Suche nach mir selbst, versuche herauszufinden, was mit mir nicht stimmt und finde die Erklärung über kurz oder lang aber dennoch immer wieder im Außen. Ich sehe mich als Opfer der Umstände, statt den Raum um mich herum zu gestalten und Verantwortung zu übernehmen.
Wieso sich selbst zu erkennen manchmal so weh tut
Aber warum finde ich mich nicht, wenn ich doch auf die Suche nach mir gehe? Weil ich Angst davor habe, was sich dann zeigt. Weil ich Angst davor habe zu sehen und anerkennen zu müssen, wie schlecht ich mich behandle. Weil ich anerkennen muss, was für eine schlechte Partnerin ich für mich war und bin. Wie wenig ich auf mich aufgepasst habe. Dass ich mein Zentrum abgegeben habe und unbeschützt ließ und der Willkür der äußeren Welt überlassen habe. Weil ich letztendlich zu feige bin, der Wahrheit in solchen Momenten in die Augen zu schauen.
Das Hier und Jetzt als Schlüssel für eine neue Ausrichtung
Jetzt wo ich wieder Luft habe und von den Geschehnissen der letzten Monate ein wenig Abstand, kann ich das alles sehen. Doch was für Schlüsse ziehe ich daraus? Oder will ich einfach abwarten und auf das Beste hoffen? Natürlich nicht! Für mich entstanden daher die folgenden Forschungsfragen: Wie gehe ich eigentlich mit meiner Zeit um? Möchte ich das so überhaupt? Und was tut mir denn wirklich gut?

Auch wenn ich diese Fragen aktuell noch nicht endgültig beantworten kann, ist eine Sache schon recht naheliegend: Langsamkeit. Ich möchte mir Zeit nehmen für Dinge, die mir wirklich guttun. Ich möchte rauskommen aus der Überreizung des Alltags und Dinge wieder bewusster erleben und konsumieren. Dafür braucht es in meinen Augen eine Inputreduzierung. Wenn weniger auf mich einprasselt, kann ich bewusster entscheiden, ob und auf was ich reagieren will. Dann bin ich nicht mehr im ständigen Abwehren, von allem, was an mich herangetragen wird, sondern es bietet sich mir eher an wie ein Buffet, von welchem ich wählen kann, was auf meinem Teller landet und was nicht. Denn was ich heute sähe, ernte ich morgen und ich möchte mir gut überlegen, was das sein soll. Das Leben ist zu kurz, um immer wieder von einer möglichen, besseren Zukunft zu reden. Unser einziger Handlungsspielraum befindet sich im Hier und Jetzt. Und diesen will ich wieder mehr nutzen. Mir genau diesen Spielraum zurückerobern. Ihn gestalten nach meinen Vorstellungen und so ausrichten, dass er mir ein gutes Morgen beschert. Willst du mitmachen? Dann schau dir meine nächsten Artikel an und erfahre, wie ich diese Reise, zurück zu mir selbst, erfahren und gestaltet habe.